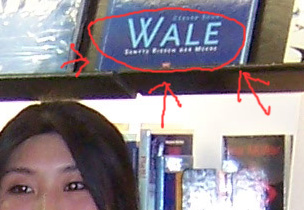Zum Anfang der Woche eine Zusammenfassung der letzten Woche, das waren nämlich zwei Wochen auf einmal: Auf 3sat war Japanwoche, in der Kantine meiner Firma war Fischwoche. Jemand da oben meinte es gut mit mir. Hier das vergleichende Protokoll.
Montag Fischwoche: Frische Forelle. Ich erwarte selbstverständlich ein großes Becken auf dem Firmenparkplatz und den Chefkoch mit einer Angel zu sehen. Sehe ich aber nicht. Nur Fisch, der aussieht wie freitags, also stark paniert. Da ist noch Luft nach oben. Japanwoche: Die Dokumentation über das Weltkulturerbe verpasse ich, ich bin noch zu beschäftigt mit Mass Effect, meinem Lieblingsspiel. Voll da bin ich erst zur Reportage über den Schienenverkehr. Es stellt sich heraus, dass japanische Bahnunternehmen bei der Planung von Abläufen, Bahnhöfen und Fahrzeugen offenbar ein Hauptaugenmerk auf die Zufriedenheit des Fahrgastes legen. Davon ist man in Deutschland noch weit entfernt, das hiesige Bahnunternehmen schert sich nicht mal um das Überleben seiner Fahrgäste. Danach österreichische Nachrichten (man ist national besoffen vom Golden-Globes-Doppelsieg, den auch Deutschland gerne für sich beansprucht), schließlich eine Dokumentation über Ryuichi Sakamoto. Die wollte ich mir eigentlich sparen, aber es ist noch Wein in der Flasche. Ohne dass es Beef gäbe, bin ich kein ausdrücklicher Sakamoto-Anhänger. Seine Filmmusiken haben mich nie groß interessiert, weil mich die dazugehörigen Filme nicht groß interessieren. Seine frühen Popplatten finde ich offen gestanden sogar ziemlich furchtbar, aber das ist nicht schlimm sondern normal. Viele Japaner meines Alters geraten in Verzückung, wenn etwas von Yellow Magic Orchestra gespielt wird, während ich, der ich diese Musik nur retrospektiv kennen gelernt habe, sie bloß unvorteilhaft aus der Zeit gefallen finde. So ist das mit den Soundtracks der Kindheit und Jugend: Man muss wohl dabei gewesen sein. Die Kinder bei uns im Haus schauen auch nur ratlos und besorgt, wenn ich mit meinen Plastikpistolen hinter der Ecke hervorspringe und „Stand and deliver!“ kreische. Im Filmportrait erweist sich Sakamoto als ein angenehmer Mensch und Gesprächspartner, der sich stets bemüht, auch auf doofe Fragen originell zu antworten. Das ist zwar mitunter etwas krampfig, aber höflich. Gleich anfangs mag Fragesteller Gero von Boehm nicht auf die abgedroschene Frage nach dem Klang der Stadt New York verzichten (findet er so toll, dass er später in anderem Zusammenhang noch mal danach fragt). Wahl-New-Yorker Sakamoto strengt sich sehr an, um schließlich mit einer Antwort über Klimaanlagen zu kommen. Drollig: Japaner finden die USA häufig überklimatisiert, während viele Amerikaner dasselbe über Japan denken. Beide Seiten haben recht. Ich werde beizeiten noch mal in Sakamoto reinhören. Voreilig gefasste Meinungen zu revidieren ist mein neuestes Hobby. Fazit: Fernsehen war besser als Essen, eine Seltenheit. Fischwoche vs. Japanwoche Zwischenstand: 0:1. Dienstag Fischwoche: Frisches Lachsfilet. Wieder wird die Frische angepriesen, wieder sehe ich nirgendwo einen Angler. Überhaupt sieht das Lachsfilet aus wie die Forelle von gestern, schmeckt auch sehr ähnlich. Erste Kollegen werden unruhig und behaupten, es handele sich in Wirklichkeit in beiden Fällen um Scholle. Man könnte bei den Verantwortlichen nachfragen, aber das könnte ja jeder. Japanwoche: Vom heutigen Programm bekomme ich nicht viel mit, weil ich am Dienstagabend immer in meinen Debattierklub muss. Als ich nach Hause komme, läuft nur noch Der Wald der Trauer, ein stiller Film über traurige Leute im Wald, der mir spontan gut gefällt, auf den ich mich nach einem einigermaßen schlauchenden Tag aber nicht mehr recht einlassen mag. Stattdessen schaue ich C.H.U.D. (Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers) Panik in Manhattan!Japanwoche: Eine Reportage über russische Fischer auf den Kurilen, eine Inselgruppe, um die sich Japan und Russland gerne streiten. Der Streit ist eigentlich interessanter als die Fischerei, aber das ist nur meine Meinung, und auf die würde ich mich nicht mal selbst verlassen. Ich kann dies und alles Nachfolgende nur mit höchstens einem Auge sehen, weil Wasch- und Schreibarbeiten parallel erledigt werden müssen, und dass der Mensch nicht multitaskingfähig ist, ist wissenschaftlich erwiesen. Lassen Sie sich von Vorgesetzten, Personalern oder Motivationsheinis nichts einreden. Ich sehe noch ein paar Bilder von der Tokioter Spaßinsel Odaiba, auf der ich mal über eine Woche allein gefangen war (für einen Tagesausflug zu zweit ist sie ganz lustig), dann läuft der Horrorfilm Ring – Das Original. Das ist löblich, aber den kann ich schon zweisprachig mitsprechen, deshalb schaue ich Sword of the Stranger
. Ist super, läuft aber außer Konkurrenz.

Donnerstag
Fischwoche: Die Belegschaft ist außer Rand und Band, es gibt Spaghetti mit Garnelen. Meine Freude hält sich in Grenzen, denn das ist genau das, was ich immer zuhause mache, wenn mir nichts Besseres einfällt. Japanwoche: Ärgerlich: Die Dokumentation Von Geishas und Gameboys ist 16 Jahre alt. Dafür kann sie nichts, aber durch die ungenügende Erwähnung dieses Umstands wird dem unbeleckten Zuschauer der Eindruck vermittelt, all die gezeigten kulturellen Trends und gesellschaftlichen Umwälzungen seien brandneu. Noch ärgerlicher ist der bevormundende Ton, den man häufig in solchen Reportagen hören muss. Westliche Beobachter wissen ja immer viel besser als echte Japaner, was echte japanische Kultur ist. Alles, was modern ist, wird hier ohne Fachkenntnis und ohne jede Bereitschaft zum genaueren Hinsehen als eklig amerikanisiert abgetan, nur Geisha, Samurai & Co. gelten als authentisch japanisch. Dass die traditionelle japanische Kultur stark von China, Portugal und sonstwo beeinflusst ist, wird nicht erwähnt. Ist wohl nicht so schlimm wie amerikanische Beeinflussung. Die Tonlage ist die, in der es im Nachkriegsfernsehen häufig besorgt hieß: „Diese jungen Leute und ihre ‚Beat‘-Musik …“ Bei scobel hat Scobel drei Gäste. Einer erzählt hanebüchenen Unsinn, einer drückt sich etwas umständlich aus, einer wird immer abgewürgt, wenn er ansetzt was Vernünftiges zu sagen, und überhaupt hört Scobel am liebsten Scobel scobeln. Okay, diese Urteile sind extrem unfair (außer das zu Scobel, das trifft den Nagel auf den Kopf), da sie sich nur auf die knapp zwei Minuten beziehen, die meine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Ansonsten bin ich stark abgelenkt durch äußere Einflüsse wie Telefon und Internet. Als Film gibt es Das verborgene Schwert
Fazit: Die Tomatensauce war schon sehr gut. 3:1 für Fischwoche. Das ist eine ziemliche Überraschung.
Sagte vorhin jemand Kamikaze? Dann kommt jetzt der Trailer für den Spielfilm Kamikaze Girls: Samstag Fischwoche: Mit der Arbeitswoche ist freilich auch die Fischwoche offiziell um, aber ich bin findig und mache mir zum Frühstück ein Garnelenbrot mit Meerrettich unten und Jalapenos oben. Herrlich. Japanwoche: Magere Ausbeute: eine Dokumentation über eine Feuerwerkerin. Interessiert mich nur oberflächlich, schaue ich nur punktuell. Fazit: Das Brot war besser, erstaunliche 4:1 für die Fischwoche. Sonntag Fischwoche: Dachte nie, dass ich das mal sagen würde: Ich kann nicht mehr. Heute gibt es Spaghetti ohne Garnelen, was Besseres fällt mir nicht ein. Japanwoche: Auf die letzten Meter will es die Japanwoche noch mal so richtig wissen. Es geht schon morgens los, aber da habe ich noch keine Zeit, denn weil die Minusgrade jetzt nur noch einstellig sind, hat die Dauerlaufsaison wieder begonnen. Am Nachmittag bin ich folglich zu kaputt zum Fernsehen. Am frühen Abend bereite ich die Spaghetti zu und kann mich leider nicht auf die Dokumentation über Ringerinnen konzentrieren. Ich werde hellhörig, als „Kaoru, die Spanplatten-Schlampe“ erwähnt wird. Ich hätte gern mehr davon gesehen. Dann endlich: Takashi Murakami, der kommerziellste Künstler der Welt. Ich liebe Murakami. Er kritisiert das Niedliche durch das Niedliche, das Oberflächliche durch Oberfläche und macht damit einen riesen Reibach von Insassen der „superflachen“ (Murakami) Gesellschaft, die er kritisiert. So verlogen mindestens sollte gute Kunst schon sein. Selbstverständlich besitze auch ich ein paar Murakamis, soll ich mal zeigen? Hier, meine Murakami-Mappen:
Und meine Buttons:

Es ist Kunst für das tägliche Leben. In einer Mappe transportiere ich die aktuellen Arbeitsbögen meines Japanischkurses, in einer sammle ich auf Reisen lose Blätter, eine hat ihren Zweck noch nicht gefunden, bis dahin bleibt sie originalverpackt und mint. Murakami hat jeden Yen redlich verdient, den ich dafür bezahlt habe.
Danach eine Doku über Essen in Japan, wurde ja Zeit. Gut und umfangreich, nur der Peter-Lustig-Bob-Ross-Erzählton nervt ein wenig. Anstatt genau zu analysieren, zeige ich ein Foto, auf dem ich Okonomiyaki mache:
Und dann badende Affen und Schluss, jetzt gucke ich noch irgendeinen bekloppten Tomie-Film, dann muss ich ins Bett, und nächste Woche will ich von Fisch und Japan nichts hören.
Fazit: Niemand schlägt Kaoru, die Spanplatten-Schlampe. Heute drei Punkte für Japan. Insgesamt: ein harmonischer 4:4-Gleichstand.

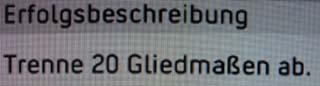
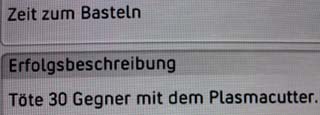







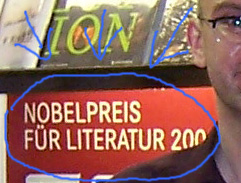 Reine Provokation:
Reine Provokation: