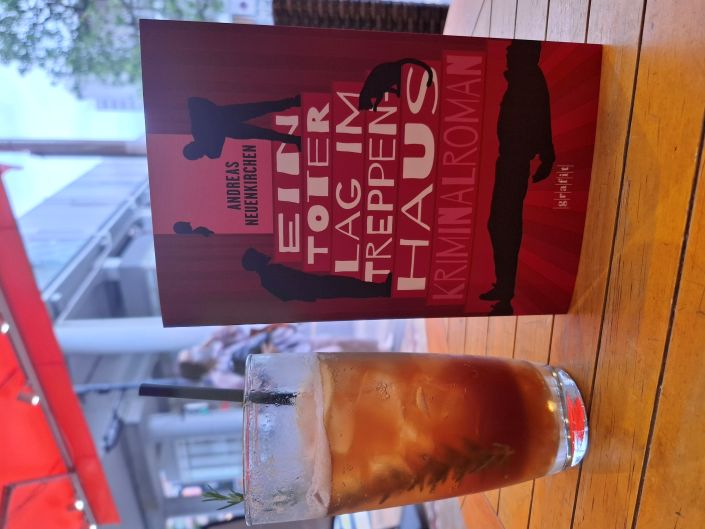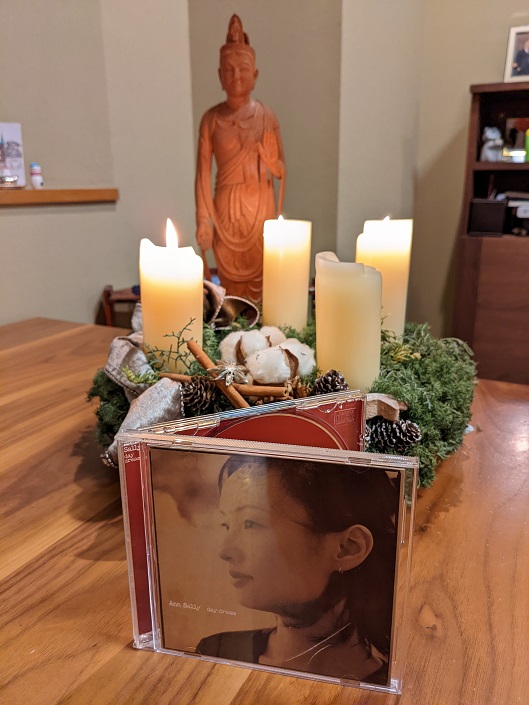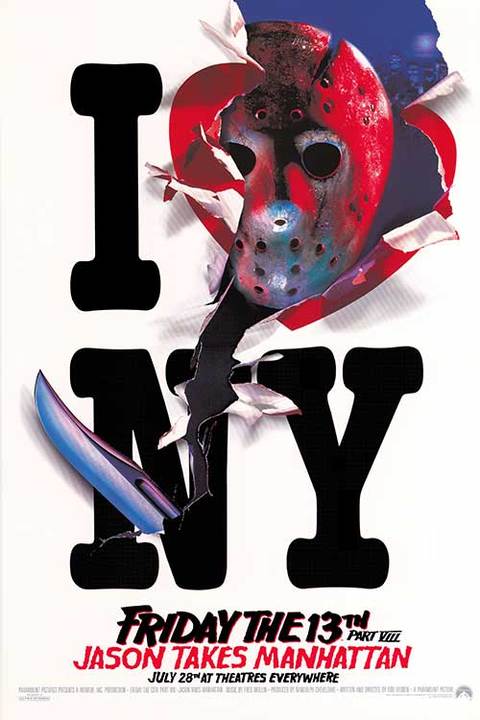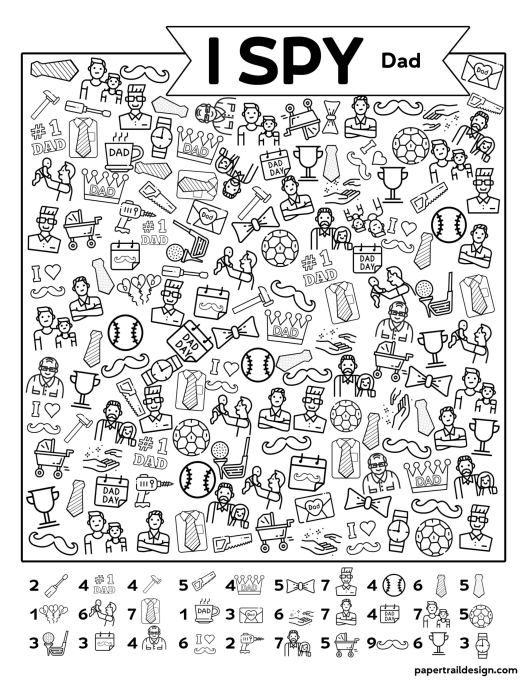Am späten Donnerstagnachmittag habe ich alles gemacht, wie ich es immer mache: Nach dem Bezahlen meines Einkaufs im Supermarkt legte ich mein Portemonnaie neben meinen Warenkorb auf den Einpacktresen, packte meine Waren vom Warenkorb in meinen ‚Wittenberge das Tor zur Elbtalaue‘-Jutebeutel um und dachte mir voller Stolz auf mein Wahlheimatland: Also in Deutschland hätte ich das Portemonnaie nicht so einfach dahin gelegt, während ich Waren umpacke. Auf dem Heimweg dachte ich darüber nach, ob ich mir noch ein Schnickschnack-Bier im Schnickschnack-Bier-Laden oder einen Eismilchkaffee vom Convenience Store gönnen sollte, entschied mich in beiden Fällen aber dagegen, denn man gönnt sich ja sonst so viel. (Hätte ich mich anders entschieden, hätte ich womöglich meinen Fehler früher bemerkt.)
Dann arbeitete ich an den vorerst letzten Schliffen meines im Frühjahr erscheinenden neuen Kriminalromans, bereitete das Abendessen zu (Teriyaki-Huhn; für mehr reicht es während heißer Romanarbeitsphasen nicht), aß mit meiner Familie zu Abend, komplimentierte meine Tochter ins Bett, arbeitete ein bisschen weiter, holte mit meiner Frau ein paar Folgen der wunderschönen neuen Daily-Morning-Soap
Boogie Woogie nach, komplimentierte meine Frau ins Bett, ärgerte mich allein ein bisschen mit dem Film
Fistful of Vengeance herum (schade, dass der nicht von meinen Steuergeldern finanziert wurde, sonst könnt ich mich noch mehr aufregen), fand schließlich selbst zur Ruh. Ich hatte einen Traum, in dem meine Tochter endlich ihre Gestaltwandler-Fähigkeiten entdeckte und damit am Esstisch allen gehörig auf die Nerven ging. Viel zu früh brach der neue Tag an. Also alles wie immer.

Am nächsten Morgen hatte meine Tochter zwar äußerlich noch ihre alte Form, aber ansonsten war sie ein bisschen schlapp, weshalb ich ihr nach Familienkonferenz schulfrei gab und zwischen Hätscheln und Arbeit multitaskte. Als ich gegen Mittag schnell mal eben zum Convenience Store wollte, um etwas zu essen zu kaufen, sagte ich beiläufig zu meiner Frau, die an jenem Tag zum Glück ‚Home-Office machte‘: „Ich kann mein Portemonnaie nicht finden.“
So weit immer noch so normal. Nur konnte ich es, anders als sonst, selbst nach elaborierten Suchaktionen nicht finden. Selbstverständlich sah ich auch im Kühlschrank und im Backofen nach, denn man kommt so langsam in das Alter. (Backofen war natürlich extrem unwahrscheinlich, da meine Frau darauf besteht, dass wir den nur in äußersten Notfällen benutzen, weil er nicht uns gehört, da wir nur zur Miete wohnen. Mein Argument, dass wir nach dieser Logik die Toilette ebenfalls nicht benutzen dürften, überzeugt sie nur teilweise.)
Schließlich musste ich erklären: „Es könnte unter Umständen eventuell sein, dass ich es gestern im Supermarkt liegen gelassen habe.“ (Tatsächlich war ich mir zu annähernd 100 Prozent sicher, schon bevor ich den Backofen geöffnet hatte.)
Nun ist die Anzahl der Unmenschen in Japan äußerst gering. Falls ich es wirklich im Laden vergessen hatte, würde jemand es beim Supermarkt-Personal oder im Polizeihäuschen gegenüber abgegeben haben. Im Normalfall. Aber Normalfall ist ja auch nicht immer. Deshalb wurde mir schon ein bisschen mulmig. Neben einem Bargeldbetrag in mittlerer Höhe waren alle meine japanischen Existenzberechtigungen, diverse internationale Kredit- und andere Geldkarten, einige Vokabelspickzettel und (besonders unersetzlich) unzählige Café- und Kaufhaus-Treuepunktekarten in der Geldbörse.
Da meine Frau noch besser japanisch spricht als ich, rief sie im Supermarkt an. Sie war ganz begeistert, wie nett und hilfsbereit die am Telefon waren, aber von meinem Portemonnaie wussten sie leider nichts. In Panik guckte ich noch mal hinter dem Backofen und unter dem Kühlschrank nach. So ein Verlust inklusive enormen Verwaltungsaufwand kommt sicherlich nie gelegen, aber gerade jetzt, wo ich kürzlich festgestellt hatte, dass ich meinen Roman zwei Wochen früher abgeben muss als ursprünglich gedacht, passte er ganz besonders schlecht in meinen Kram.
Meine Frau versuchte unser nachbarschaftliches Polizeihäuschen. Da hatte ich keine große Hoffnung, gerade weil ich wusste, wie gewissenhaft die Guten dort arbeiten. Einmal bestand meine Tochter darauf, dass wir eine Brosche, die sie auf dem Schulheimweg gefunden hatte, dort ordnungsgemäß abgäben. Sie hatte im Unterricht gerade das Konzept der Polizei als Freund und Helfer durchgenommen, und ich habe den Verdacht, dass sie mit Adleraugen den Boden abgesucht hat, nur um irgendetwas zu finden, das man zur Polizei bringen könnte. Obwohl ich kein Broschenexperte bin, hatte ich das Stück schnell als billigen Tand erkannt, den bestimmt niemand vermissen würde. Trotzdem wollte ich mein Kind nicht enttäuschen. Im Polizeihäuschen stellte sich das Abgeben nicht als ein einfacher Hallo/hier/tschüs-Vorgang heraus, sondern war mit allerlei Papierkram, schwierigen Fragen, Faltkartenstudium und lustigen Pocketalk-Maschinenübersetzungdialogen gespickt. Man war wirklich wild entschlossen, die rechtmäßige Besitzerin des billigen Plastikteils zu finden. Wenn die mein Portemonnaie hätten, so dachte ich, hätten die mich längst informiert; Adressdaten waren schließlich enthalten.
Gar so groß ist das Servicebewusstsein der Lokalpolizei nun anscheinend auch wieder nicht. Ja, sie hätten ein Ausländer-Portemonnaie erhalten, auf das die Beschreibung zuträfe, wurde meiner Frau mitgeteilt. Die Sache war aber eine Nummer zu groß für unser schnuckeliges kleines Polizeihäuschen, deshalb hatte man das Fundstück bereits zum nächsten vollwertigen Polizeirevier im benachbarten Himonya geschickt. Nun hätte ich sagen können: „Boah, echt ey?! Das sind ja 17 Minuten zu latschen, Alter!“ Stattdessen sagte ich sinngemäß: „Oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott super toll spitze irre mega!“ Man gab mir eine Bearbeitungsnummer, mit der ich bevorzugt behandelt werden würde, und empfahl mir, bis 16:30 Uhr aufzukreuzen, weil man sonst wg. Feiertag erst am Dienstag wieder für mich da sein könnte (das erinnerte mich durchaus ein bisschen an meine alte Heimat).
Ca. 17 Minuten später betrat ich zum ersten Mal in meinem Leben ein japanisches Polizeirevier. Es unterschied sich zum Glück nicht wesentlich von den Mutmaßungen in meinen vier in Tokio spielenden Polizeiromanen (recherchiert hatte ich freilich schon). (Ich möchte keine Namen nennen, aber es gibt einen Tokio-Krimi von einem anderen deutschen Autor, in dem behauptet wird, man müsse in japanischen Polizeirevieren die Schuhe ausziehen. Das habe ich stets bezweifelt, und Einheimische, die ich dazu befragt habe, zweifelten ebenso, obwohl die zu unbescholten waren, um es abschließend beurteilen zu können. Nun weiß ich: Wir lagen richtig.) Das einzige, was mich wunderte, war, dass doch etliche der Officers Schusswaffen trugen. Eigentlich heißt es ja immer, und ich hatte das selbst in Fiktion und Non-Fiktion kolportiert, dass dem in Japan nicht so sei. Vielleicht an jenem Tag ausnahmsweise, weil ich da war.

Vom freundlichen jungen Mann am Empfang bekam ich einen Besucherausweis und den Auftrag, mich im zweiten Stock zu melden. Die freundliche junge Dame dort rief bei meinem Anblick sofort: „Saifu!“ (Portemonnaie) Ganz kurz musste ich mich gedulden, dann händigte mir ein freundlicher älterer Herr mein Portemonnaie aus.
Ich war schockiert, dass es nur die nackte Geldbörse war, ohne irgendwas drin. So hatte ich mir Japan nicht vorgestellt.
Doch dann ging die Übergabe ordnungsgemäß weiter, in thematisch geordneten Stapeln. Die Kreditkarten, die Ausweis- und ausweisartigen Dokumente, die Spickzettel und (ein Glück!) die Treuepunktekarten. Schließlich die Geldscheine und die Münzen. Selbstverständlich alles da. Natürlich musste ich noch ein Formular ausfüllen, obwohl ich am Empfang schon eines ausgefüllt und meine Frau davor bereits alle Daten zum Mitschreiben diktiert hatte. Wir dürfen aber auch die Bedürfnisse der japanischen Papier- und Stempelindustrie nicht vergessen.
Ich versprach, dass es nicht wieder vorkommen würde, was dem älteren Beamten große Freude und Erleichterung zu bereiten schien (das Gefühl kannte ich von kurz vorher nur allzu gut), und ging mein wie-neues Geld auf den Kopf hauen.

Zu Hause nötigte mich meine Frau zuzugeben, wie toll solche Dinge in Japan funktionierten (ich habe nie etwas anderes behauptet). „DARÜBER solltest du mal was schreiben!“, meinte sie. Habe ich in der Vergangenheit bereits öfter getan. Kann man aber ruhig noch mal schreiben.