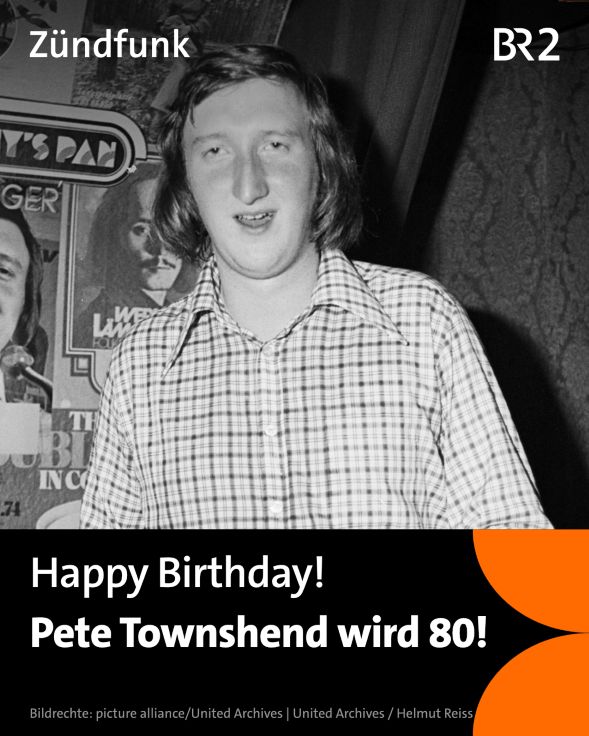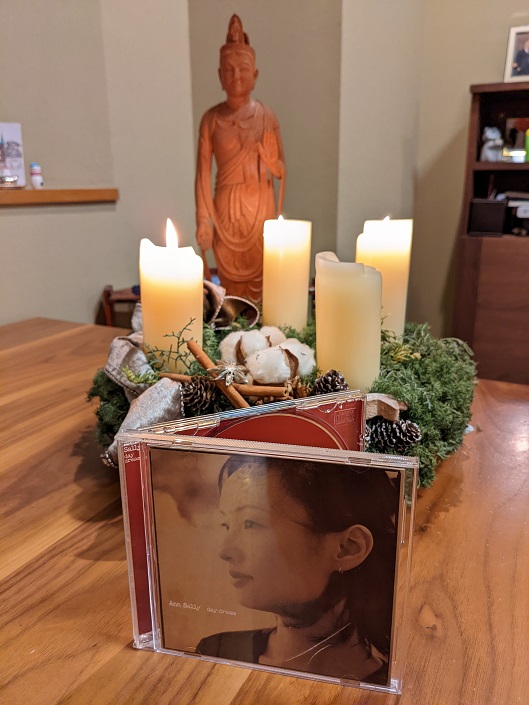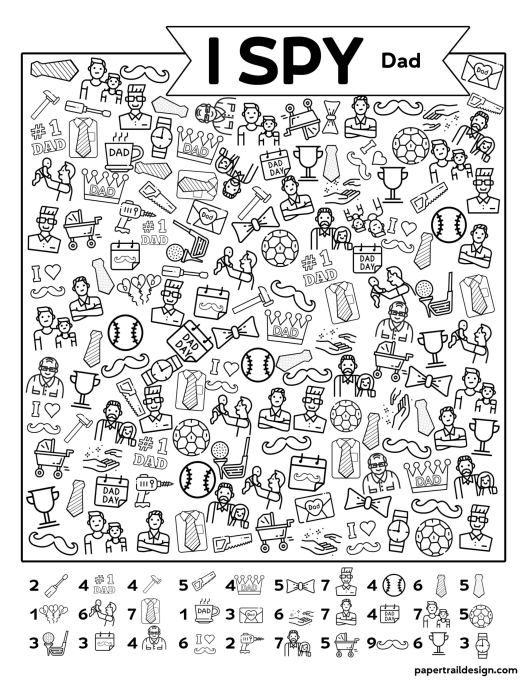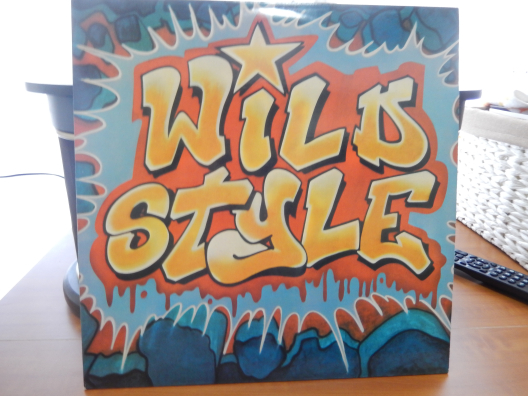Das Jahr 2016 scheint vor allem dafür bekannt, dass in seinem Verlauf, zumindest nach Augenmaß, überdurchschnittlich viele Personen des öffentlichen Lebens gestorben sind, die einem etwas bedeuten, so man in eine gewisse Altersspanne fällt. Abseits dieser Altersspanne wurde dieser Umstand mit weniger Wut, Trauer und Betroffenheit aufgenommen. In der Zeit (glaube ich) oder einer ihrer Ablegerpublikationen (könnte sein) erschien seinerzeit ein vieldiskutierter (meistens zurecht verlachter) Artikel eines Nachwuchsjournalisten, dessen Grundtenor war: Meine Freunde und ich kennen diesen Prince gar nicht, er kann also kaum so wichtig gewesen sein wie Justin Bieber oder Maximo Park. Jenseits des anderen Endes der Altersspanne wird, beispielsweise, „dieser Prince“ auch für, beispielsweise, meine Eltern kaum mehr gewesen sein als eine vage Erinnerung aus meinem Kinderzimmer. Vielleicht verwechselten sie ihn sogar mit „diesem Adam Ant“.
Offenen Auges müsste man zugeben, dass es 2016 durchaus wichtigere Nachrichten gab als tote Prominente, so sehr der eine oder andere Verlust tatsächlich schmerzte. Hat man allerdings gerade im fortgeschrittenen Alter einen Überseeumzug gestemmt, hat man zunächst gänzlich andere Prioritäten als die Sondierung der internationalen Nachrichtenlage. Da geht es um die Grundbedürfnisse des Menschen, die essenziellen Fragen, wie zum Beispiel: Werde ich ein Nudelrestaurant in meiner Nähe finden, in dem ich von nun an fast jeden Tag essen werde, und zwar fast jeden Tag dasselbe?
Ich habe meines gefunden, es sieht so aus:

Dort esse ich fast jeden Tag Mazesoba. Hier im Urzustand:

Dann so: maze, maze, maze.

Und dann essen, und dann war es wie immer gut.

Die Nudeln müssen mit Geld bezahlt werden. Nur ist das mit dem Geld so eine Sache, und zwar eine ungerechte. Mein Plan war es, das Nudelgeld mit dem Schreiben von Büchern und Zeitungs- beziehungsweise Zeitschriftenartikeln zu verdienen. Grob gerechnet bekommt man für drei oder vier Artikel in einigermaßen großen Publikationen (ein paar Tage Arbeit) so viel Geld wie für ein Buch in einem relativ kleinen Verlag (ein paar Monate Arbeit). Leider macht aber das Schreiben von Büchern mehr Spaß als das Schreiben von Artikeln (fürs Schreiben im eigenen Blog bekommt man übrigens gar kein Geld, so man keine unseriösen Reklameanzeigen nebenan haben mag). Zum Glück bin ich modern genug, mich eine Weile von meiner Frau aushalten zu lassen. Drum entschloss ich mich, in diesem Jahr rein nach Spaßprinzip zu schreiben. Also erstens Bücher, zweitens einfach so drauf los. Normalerweise misstraue ich Buchideen, bei denen sich nicht zumindest Anfang und Ende innerhalb von fünf Minuten von selbst offenbaren. Aber diesmal wollte ich so schreiben wie früher, als die Welt noch jung und die Zukunft ungeschrieben war und jeder Morgen nach frisch gemähtem Rasen und Aufbruch duftete. Deshalb habe ich nun einiges gänzlich Unerwartetes in der virtuellen Schublade, zum Beispiel:
- Die ersten Worte einer interdimensionalen, ultrabrutalen, mechaerotischen Weltraumoper (also wahrscheinlich Jugendbuch).
- Fragmente eines großstädtischen Quatschkopfromans, mit dem ich es in erster Linie auf den Ingeborg-Bachmann-Preis und/oder eine Verfilmung im Stile Woody Allens abgesehen habe.
- Und natürlich – was soll man in Tokio auch anderes schreiben? – einen High-Concept-Entwurf für eine München-Moosach-Krimireihe.
Vielleicht sollte ich per Publikumsvotum entscheiden lassen, was ich davon ernsthaft weiterverfolge. Sollte es die Weltraumoper werden, müsste ich allerdings herausfinden, wie ich das Gesicht meiner Agentin verletzungsfrei wieder aus ihren Handflächen entfernen kann.
Nicht aufgeführt sind übrigens die zweieinhalb Projekte, bei denen ich vorsichtig optimistisch davon ausgehe, dass sie bald tatsächliche Spruchreife erlangen, ebenso wie die zwei vorläufig ausgereiften Projekte, die bereits hoffnungsfroh ihre Verlagsrunden drehen. Faul war ich also nicht, ich sah nur aus der Ferne so aus.
Sind die Nudelfragen geklärt und summt und brummt die Arbeitsroutine verlässlich vor sich hin, ist es auch im Neuen Leben an der Zeit, sich wieder für das Weltgeschehen zu interessieren. Schon früh hatte ich den Entschluss gefasst, mein Neues Leben solle langsamer und analoger werden – weniger postfaktisches Internet, mehr gedruckte Lügenpresse. Drum abonnierte ich sofort alles, was mir in die Quere kam und neuen Abonnenten einen Gratis-Jutebeutel versprach. Und kam bald mit der Lektüre nicht mehr hinterher.
Nun gibt es nichts Bekloppteres als den Spruch, nichts sei so alt wie die Zeitung von gestern. Wer nach Gesichtspunkten der Tagesaktualität Zeitung liest, bräuchte das wirklich nicht zu tun, da haben die Digitalhektiker ausnahmsweise recht. Qualitätsjournalismus lese ich auch gerne mal ein paar Tage oder eine Woche später. An den Weltereignissen ändert es ja nichts, ob ich sofort von ihnen erfahre oder erst nach allen anderen. Wenig ist mir so zuwider wie die polternde Beschwerde, diese oder jene Medien (im Zweifelsfall das deutsche Fernsehen) berichteten nicht schnell und live genug von den neuesten Gräueltaten. Informationsjunkies sind eben auch nur Junkies, zu beschönigen oder gar zu glorifizieren gibt es an diesem Zustand nichts.
(Wenn ich von mir ausgehe – und von wem sollte ich sonst ausgehen? – , dann glaube ich übrigens, dass die Fernsehnachrichten vor den Tageszeitungen aussterben werden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sitzen und in eine bestimmte Richtung sehen zu müssen, um in vorgeschriebenen Tempi und starren Formaten informiert werden zu dürfen, erscheint mir schon heute absurd. Doch das nur am Rande.)
Dennoch: Wenn Entschleunigung in Überforderung umschlägt, muss eingeschritten werden. Es geht nicht an, dass hier noch ungelesene Zeitungen von vorm Nikolaus liegen. So habe ich gleich meinen ersten Vorsatz fürs Neue Jahr: Mindestens die Hälfte meiner Abonnements wieder abbestellen. (Das wird wohl auch dich betreffen, lieber
New Yorker. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Deine Cartoons sind zwar so überschätzt wie die Interviews im
Playboy, aber deine längeren Artikel habe ich stets gern gelesen. Beziehungsweise lesen wollen, wenn ich die Zeit gehabt hätte. Habe ich jedoch nicht. Nicht jede Woche. Wenn du dich zu einem monatlichen oder quartalsweisen Erscheinungsturnus entscheiden könntest, würde ich es mir noch mal überlegen. Was ich eigentlich sagen wollte: Den Abonnenten-Jutebeutel, der mir vertraglich zusteht, möchte ich trotzdem noch haben. Alle anderen Zeitschriften haben mir den Abonnenten-Jutebeutel unaufgefordert zugeschickt. Also bitte zack-zack.)
Für die wirklich wichtigen Nachrichten müssen wir heuer selbstverständlich einen bangen Blick nach Amerika werfen:
Rogue One. Oft hörte ich die Einschätzung: Erst gähn, dann geil. Mir ginge es, falls ich mich überhaupt jetzt schon zu derlei extremen Urteilen hinreißen lassen müsste, eher umgekehrt. Eigentlich geht es mir hier aber gar nicht um die Qualität des Films, die kann man bei einem emotional so komplexen Lebensaspekt wie
Krieg der Sterne ohnehin frühestens nach vier oder fünf Durchläufen vorläufig abschließend beurteilen, sondern darum: Es scheint, als war 2016 das Jahr, in dem Krieg-der-Sterne-Filme ganz normal geworden sind. Schon weiterhin Eventereignisfilme, auf die man sich flatternden Herzens freut. Doch flattert es nicht mehr gar so stark, dass man vorher nächtelang nicht schlafen kann (anders also als letztes Jahr noch). Seit Disney dankenswerterweise das ganze Unternehmen übernommen hat, ist bekannt, dass es fortan jährlich einen neuen Krieg-der-Sterne-Film geben wird. Wenn nicht Episode-Irgendwas, so doch irgendein Spinoff-Prequel-Oneshot-Standalone-Crossover-Hastenichgesehn-Dingsbums. Ein Film pro Jahr ist noch kein Overkill, hatte ich gedacht, und das ist es auch nicht. Nichtsdestotrotz bemerke ich bereits einen starken Gewöhnungseffekt und hoffe, dass es nicht soweit kommen wird wie bei den Superheldenfilmen, die ich nun immer häufiger auslasse (letzter ausgelassener war der letzte Gruppe-X-Film, nächster wird der nächste
Guardians of the Galaxy). Das wäre schade, denn meine Familie gibt mir nur zu Krieg-der-Sterne- und Godzilla-Filmen frei.

Den letzten Godzilla-Film kann ich leider nicht beurteilen, weil ich leichtsinnig vor dem Film ein Bier getrunken hatte und dann im Kino eingeschlafen bin. Das ist jetzt so das Alter, und das wird im nächsten Jahr bestimmt nicht besser.