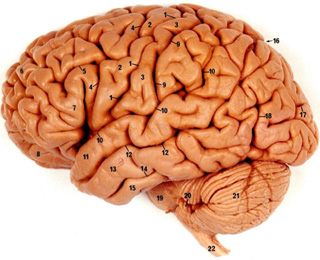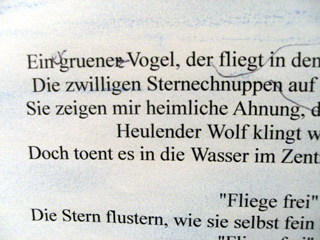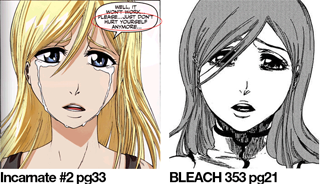Vor ein paar Jahren unternahm ich eine Bildungsreise durch die Biermuseen Japans. Wie es sich gehört, kaufte ich dabei in den Museumsandenkenläden mehrere Postkartensets mit nostalgischen Motiven aus der Bierplakatreklame. Auf den meisten Karten war ein Bier in einer Flasche oder einem Glas und ein Mensch abgebildet, mal ein Mann, mal eine Frau. Lebenserfahrung zeigt, dass Frauen und Bier immer eine gute Kombination sind, während Männer und Bier schnell langweilig wird. Zu Hause also wanderten die Karten mit Frau/Bier-Abbildungen an die Wand, die Männer-Postkarten in eine ‚Zeug-das-ich-später-mal-wegschmeiße‘-Schublade, in der noch Platz war. Ich nahm mir allerdings fest vor, die Männerpostkarten vielleicht einmal als Lesezeichen zu verwenden, damit sie sich nicht ganz so nutzlos vorkommen, wie sie sind.
Leider eignen sich Postkarten in Größe und Konsistenz selten als Lesezeichen. Man braucht schon ein Buch, das was aushält. Wie zum Beispiel
Role Models
, John Waters‘ jüngst erschienenes, längst überfälliges Newsupdate zum War on Taste. Zur Markierung meines Lesefortschritts wählte ich durch Zufall diese Postkarte:

Ein Motiv, das bei der ersten Begutachtung überhaupt nicht zu mir gesprochen hatte. Was sagt dieses Bild? Dicke Männer trinken gerne Bier. Was für ein Unsinn! Ich schaue auch Werbung, daher weiß ich, dass nur gut gebaute, charismatische Haudegen gerne Bier trinken. Männer wie du und ich.
Nun war es in letzter Zeit sehr heiß, da liest man nur in kurzen Schüben. Ständig ging die Karte rein und raus, und je öfter ich sie dabei betrachtete, desto mehr freundete ich mich mit ihr an. Eigentlich sieht der Typ doch ganz sympathisch aus. Zu viel Lippenstift hin oder her, sein Lächeln wirkt aufrichtig und einladend. Seine Frisur und sein Schnauzer mögen für sich etwas komisch aussehen, aber sie passen gut zur Gesamterscheinung. Und so dick ist er auch wieder nicht, genau betrachtet.
Das Bild kommuniziert freilich nicht nur, dass der gar-nicht-so-dicke Mann gerne Bier trinkt, sondern auch mit Erfolg Golf spielt, die schönste Sportart der Welt. Sturzlangweilig anzuschauen und modisch völlig inakzeptabel (wie allerdings jede Sportart außer Eiskunstlauf), in der Ausübung aber ein Fest für Körper, Geist und Seele. Zu dumm (und komplett unverständlich), dass ausschließlich Schwachköpfe Golf spielen, sonst wäre ich sofort dabei. Vielleicht könnte man die Gebühren und Ausrüstung teurer machen, damit nicht mehr jeder Hans und Franz auf den Platz kommt.
Der Mann auf der Postkarte ist bestimmt kein Schwachkopf, das spüre ich. Das schönste Detail des Bildes ist rechts unten: Da steht noch ein Bier auf dem Tisch. Es lädt ein, sich zu dem Mann zu setzen, und mit ihm auf seinen frisch gewonnenen Pokal anzustoßen. Eine Bierwerbung kann ein Freund sein, und diese ist mir einer geworden. Ich habe Mr. Waters‘ Buch längst ausgelesen und verwende ein Lesezeichen niemals für mehr als ein Buch (ein nervöser Tick), aber diese Postkarte ist mir dennoch zum ständigen Begleiter geworden. Sie liegt auf meinem heimischen Schreibtisch, wenn ich daheim bin. Gehe ich aufs Amt, packe ich die Karte so selbstverständlich ein wie das Butterbrot und lege sie auch dort auf meinen Schreibtisch.
All die Jahre wurde mir nachgesagt, in erster Linie von mir selbst, ich hätte eine Schwäche für
japanische Frauen. Aber jetzt weiß ich, ich habe mir und der Welt nur etwas vorgemacht, eine Lüge gelebt, ein richtiges Leben im falschen versucht, was es bekanntlich nicht geben kann. Ich muss feststellen: Ich habe in Wirklichkeit eine Schwäche für japanische Männer. Zumindest für die aus der Bierwerbung.
Verblüffend ist die Erkenntnis nicht. Schließlich berichtete schon der neunundneunzigmalkluge Jeffrey Eugenides in seinem 2002er Saisonbestseller
Middlesex davon, dass der Hang zu asiatischen Frauen beim Manne nur das Vorzeichen einer noch nicht diagnostizierten Homosexualität sei, weil diese Asiatinnen ja alle so knabenhafte Körper haben. Haben Sie das gewusst, liebe asiatische Ehefrauen? Erstens, Sie sehen gar nicht aus wie Frauen. Zweitens, Ihr Mann ist schwul. Ich hatte das vorher auch nicht gewusst. Ich hatte ja noch nicht mal gewusst, dass Knabenliebe und Homosexualität jetzt doch dasselbe ist. Ich hatte angenommen, die Theorie gälte als überholt, seit Menschen in weiten Teilen der Welt nicht mehr öffentlich verbrannt werden, wenn sie sagen, dass sich vielleicht die Erde um die Sonne dreht. Aber ich muss mich geirrt haben, Dr. Eugenides wird es schon wissen. Keine Ahnung, ob er einen Doktortitel hat, aber bestimmt, soviel wie er weiß.
Ich jedenfalls habe sofort gesucht, ob ich noch mehr der einst verschmähten Männerpostkarten wiederfinde. Leider fand ich nur eine, die hier:

Auch eine sympathische Type, ein Lebemann, der weiß, was das Leben lebenswert macht.
Aber wo schaut der denn da hin?!
Andererseits, ich kann ihn verstehen, wenn ich sie mir so ansehe, mit ihren knabenhaften Körpern und rauen, männlichen Posen …
Aber nein, ich darf mich da nicht reinsteigern. Das wäre ein Rückschritt in meiner menschlichen und männlichen Entwicklung. Ich war doch schon weiter. Ich bin so verwirrt, weiß nicht mehr, wo ich hingehöre. Schuld ist die Werbung. Und Jeffrey Eugenides. Und Ayako Imoto.