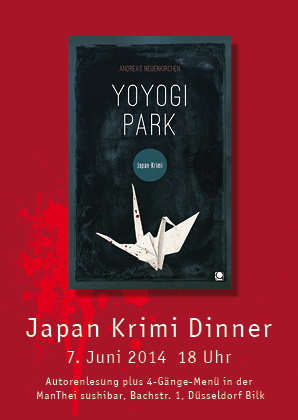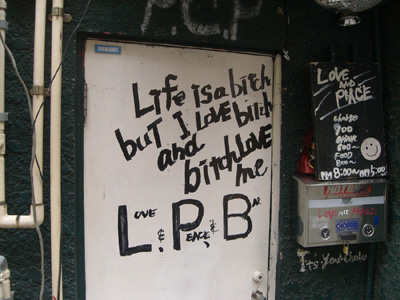Jetzt ist sie wieder vorbei, die Zeit, in der die Hälfte meiner Facebook-Freunde in heller Aufregung Sportergebnisse postet, und die andere Hälfte blasierte „War was?“-Kommentare. In aller Freundschaft: Ich finde das erste unnötig, und das zweite unnötig und kindisch. So eine WM ist keine Ganz-oder-gar-nicht-Geschichte, kein Die-oder-wir, kein Proleten-gegen-Schöngeister, es besteht keine absolute Bekenntnisnotwendigkeit. Nichtsdestotrotz bekenne ich mich heute: Ich bin die Art von Fußballgucker, auf die gewohnheitsmäßige Fußballgucker herabsehen. Ich gucke nur zu Großereignissen, es muss schon WM sein, ersatzweise auch mal die der Herren, und auch dann erst, wenn es spannend wird. Und das ist auch gut so. Stolz bin ich darauf freilich nicht, denn stolz kann man nur auf etwas sein, was einen große persönliche Anstrengungen gekostet hat. Zum Beispiel: ein Fußballspiel mit den eigenen Füßen zu gewinnen, oder nach spektakulären Fluchten und langem Spießrutenlaufen die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Einfach nur ein gewonnenes Fußballspiel im Fernsehen gesehen zu haben oder zufällig irgendwo geboren worden zu sein wäre als Ursache für Stolz ein wenig befremdlich.
Selbstverständlich stören mich die grölenden, bemalten Dooffans, die bereits vor der Halbzeitpause zu besoffen von Heimatgefühl und sonst was sind, um noch etwas vom Spiel mitzubekommen (in diesem Zusammenhang ist es schon sehr passend, dass man unter dem deutschen Begriff
public viewing im Englischen das öffentliche Aufbahren von Leichen versteht). Gottseidank gibt es davon in meinem Haushalt keine. Mehr noch als diese kaum noch lebenden Toten stören mich allerdings zunehmend die ständigen Flunschzieher, die ihre Fußball-Ablehnung ausstellen wie eine elitenbildende Zierde. Also so Typen wie mich vor 2011, dem Jahr der letzten echten WM und meiner Epiphanie. Typen, die sich tatsächlich darüber beschweren, dass alle vier Jahre nachts mal einer hupt. Dabei sind einige dieser Typen noch in dem Alter, in dem es eigentlich ihre Pflicht wäre, selbst ab und an für nächtliche Ruhestörung zu sorgen. Kommen die Menschen inzwischen schon als „Runter-von-meinem-Rasen!“-Greise auf die Welt?
Meine Frau ist Ausländerin und schwanger. Das ist in diesem Zusammenhang deshalb erwähnenswert, weil erstens Zugereiste beim Themenkomplex Deutschland ja meist fanatischer sind als Alteingesessene, und zweitens weil es ihr wichtig war, dass unsere Tochter in einem historischen Jahr geboren wird. In anderen Worten: bei Deutschland-Spielen war auf dem Sofa eine Stimmung, dass ich Angst hatte, vorzeitige Wehen könnten jederzeit einsetzen.
Die Frage nach mannschaftlicher Loyalität sehe ich entspannter als sie. Man muss nicht zwangsläufig für das Land jubeln, in dem man Steuern zahlt und Rente bezieht. Man darf aber. Es hängt ganz von der Erzählung ab, denn die ist das schöne an sportlichen Großereignissen. Es handelt sich im Grunde um Helden- und Schurken-Epen mit allem Drum und Dran, nur dass anders als in der literarischen Epik die dramatischen Höhepunkte, überraschenden Wendungen, Sympathien und Antipathien nicht festgeschrieben sind, sondern sich während des Erzählens ergeben. Deshalb fände ich es Unsinn, von vornherein für eine bestimmte Mannschaft Partei zu ergreifen. Protagonisten müssen sich erst herausschälen. Mein Lieblingssieger wäre diesmal Costa Rica gewesen. Aber als das nicht mehr ging, hatte ich keine Probleme damit, den deutschen Spielern meine Gunst zu vermachen, die waren mir auch ganz sympathisch.
Die Qualität der Erzählung ist auch der Grund, warum ich mich nicht für das Klein-klein der lokalen und regionalen Vereinsmeierei interessiere. Wenn die WM ein Epos ist, dann ist Dingsbums-Liga (keine Ahnung, was es da alles gibt und wie das heißt) eine Daily Soap. Dafür fehlen mir Ausdauer und Geduld. Außerdem finde ich Lokalpatriotismus noch bekloppter als Nationalpatriotismus. Ich habe da schlimme Erinnerungen an 2010, als ich in Tokio ein Konzert eines skandinavischen Akustik-Pop-Duos besuchte, und eine Frau im Publikum immer die ruhigen Stellen abwartete, um sinnlos in den dunklen Saal zu brüllen: „KREUZBERG!!! KREUZBERG!!!“ Ich habe das Gesicht der Dame (ich benutze den Begriff euphemistisch) nicht gesehen, doch ich bin mir sicher: Es war die hässliche Fratze des Lokalpatriotismus.
Weil mir gerade kein guter Übergang zum Rest des Textes einfällt, zeige ich in der Halbzeitpause eine Plastiknachbildung eines brasilianischen Fußballspielers unter einem originell verpackten Stück Weichkäse. Ist nicht böse gemeint.

Das zaghafte Erwachen meines Interesses am Fußball unter bestimmten Bedingungen geht leider auch einher mit einigen Enttäuschungen, vor allem im journalistischen Bereich. Das erinnert mich an die Zeit, als mein Interesse an Mode (etwas weniger zaghaft) erwachte. Man muss nur genauer hinsehen, und man erkennt selbst als Laie beim Fußball wie beim Modedesign unendlich viele Spielarten und Facetten von Spielarten. Als Freund des geschriebenen Wortes juckt es einem sofort in den Fingern, etwas darüber zu schreiben. Doch als Mensch mit Erfahrung widmet man sich erst mal der Lektüre derer, die darüber schon länger und vermeintlich berufen schreiben. Da findet sich dann die nächste Parallele zwischen Mode und Fußball: der Journalismus ist auf beiden Feldern ein Graus. Schnarchlangweilig, verliebt in Plattitüden und fasziniert von Nebensächlichkeiten, entweder zu fachidiotisch oder zu allgemeinidiotisch, buchhalterisch ergebnisorientiert. Unter ähnlichen Problemen, dem schnöden Beschreiben von Technik anstatt des Erschreibens von Bedeutung, leidet übrigens auch – immer noch, obwohl ich es schon so oft gesagt habe – der Journalismus über Computer- und Videospiele. So wird das nichts mit dem Ernstgenommenwerden.
Ach, es gibt bestimmt Ausnahmen, wunderschöne Fußballdichtung, es gibt die gelungenen Einzelfälle ja auch in der Berichterstattung über Mode und Spiele. Aber die beim Sport jetzt auch noch zu suchen ist mir zu mühselig, die Uhr tickt. Dann lese ich lieber nicht, sondern schaue nur. Da hat man dann den Kommentar des Kommentators, des undankbarsten Berufes des Landes, gleich nach Kanzlerin und Politesse, saisonabhängig auch mal davor. Wie jeder andere Zuschauer und -hörer denke ich mir manchmal (eigentlich ziemlich oft): Das krieg ich auch noch hin. Und ich habe nun wirklich keine Ahnung von Fußball. Diesmal habe ich etwas genauer hingehört und muss relativieren: Das kriege ich auch noch hin, wenn man mir ein paar Wochen Zeit gibt, mich in das Thema einzulesen und die Namen auf den Rücken auswendig zu lernen. Allerdings müsste ich dann ja genau den Journalismus lesen, den ich eben nicht lesen möchte. Es ist ein Teufelskreis, vermutlich werde ich doch kein Sportreporter mehr.
Ich möchte diesem Berufsstand gar keine allzu großen Vorwürfe machen, 90 Minuten oder länger geistreich, eloquent und kompetent zu improvisieren ist nicht leicht, da muss man vom Sofa aus nicht jeden verbalen Fehlpass auf die Goldwaage legen. Außer man hat Spaß daran. Meiner Frau und mir ist aufgefallen, dass in den Kommentaren überraschend häufig der Begriff
harakiri fiel. Meine Frau sah mich bei diesem Schlüsselreiz jedes Mal fragend an, auf dass ich ihr erkläre, was damit gemeint sei. Ich weiß aber nicht, was das in der Fußballsprache bedeutet. In der japanischen Sprache bedeutet es ‚Bauch aufschneiden‘, in der deutschen Sprache wird es bisweilen synonym mit dem Begriff für rituellen Selbstmord, eigentlich
seppuku, verwendet, wobei ich nicht so kleinlich sein möchte wie der gemeine Japanischgenaunehmer. Der Fußballkommentator hat immer dann von
harakiri gesprochen, wenn irgendjemand eine spielerische Dummheit begangen hatte. Was genau das mit Bauchaufschneiden oder Selbstmord zu tun hat, selbst auf einer symbolischen Ebene, erschließt sich mir auch nach längerem Brüten nicht, da hinterher weder jemand tot (konkrete Bedeutung) noch das Spiel verloren (übertragene Bedeutung) war. Bei einer Situation hatte ich das Gefühl, der Kommentator meinte nicht
harakiri, sondern
kamikaze. Vielleicht ist einfach irgendein japanischer Begriff gut genug. Dann heißt es bald: Messi leistete sich einen echten
sashimi, aber Neuer voll so
mitsubishi.
Der heißt Neuer, oder? Ich glaube, ich habe während der WM immer Neuner gesagt, und höflicherweise hat mich niemand korrigiert. Ich kannte ihn vorher nicht, und jetzt eigentlich auch nicht. Ich weiß nur, dass er gut gehalten hat, und dass die japanische Presse orakelt, er sei schwul, weil er so gut aussieht. Möglicherweise orakelt das die hiesige Presse ebenfalls, ich müsste halt mal reinlesen.
Apropos Neuer: Hier ein Bild vom Alten, das ich 2004 in Tokio geschossen habe.