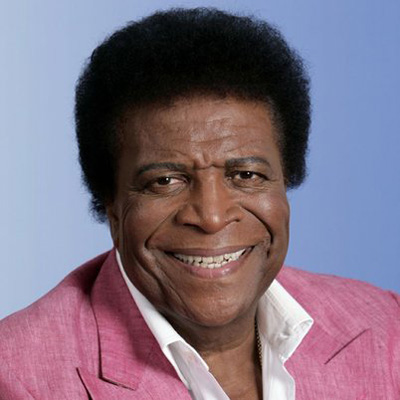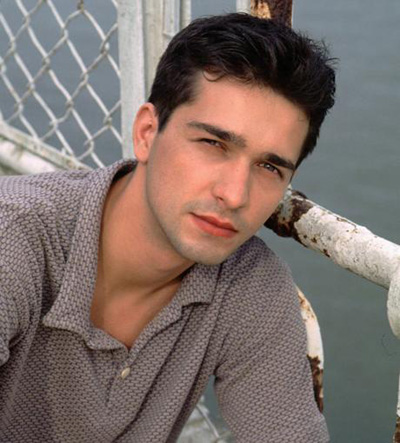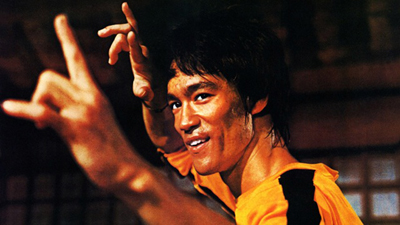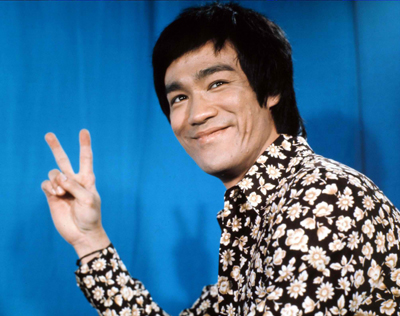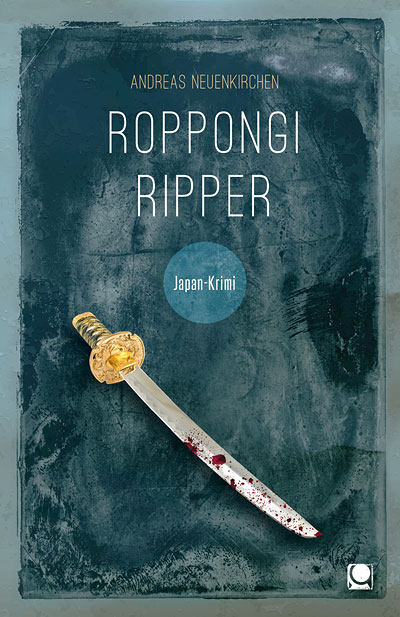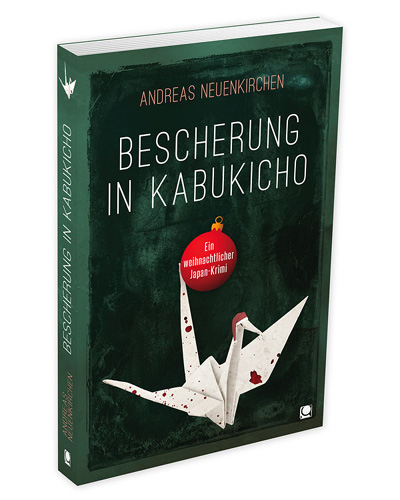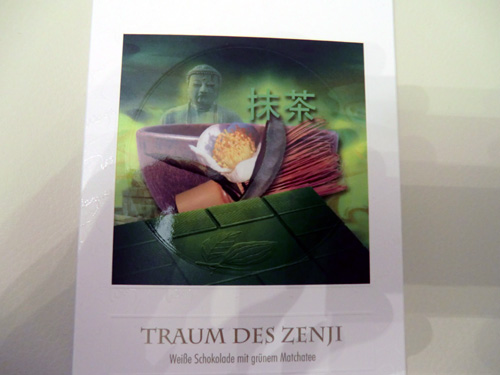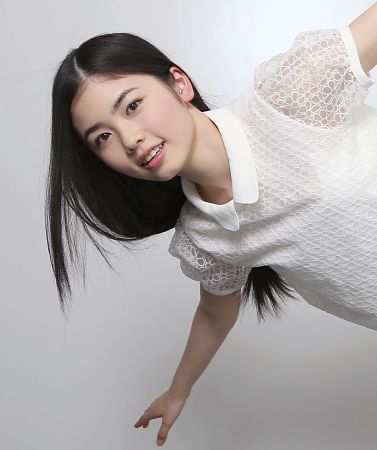[Sicherheitshinweis: Wie jeder aussagekräftige Sekundärtext geht auch dieser auf den Inhalt seines Primärtextes ein. Oder, im Mimimi-Memmen-Duktus: Spoiler-Warnung.]
Keine Fernsehnachricht hat mich in diesem Jahr so begeistert wie die Ankündigung der vorletzten Woche, es solle zwei neue Folgen
Luther geben. Zwei richtige neue Folgen, Folgen aus der Zukunft, keine sinnlose Prequälerei, wie es wohl mal angedacht war. Womit ich nicht sagen möchte, dass alle Prequels sinnlos wären. Allenfalls die allermeisten. Ausnahmen gibt es bestimmt. Wir machen weiter nach einer kurzen Werbeeinblendung.
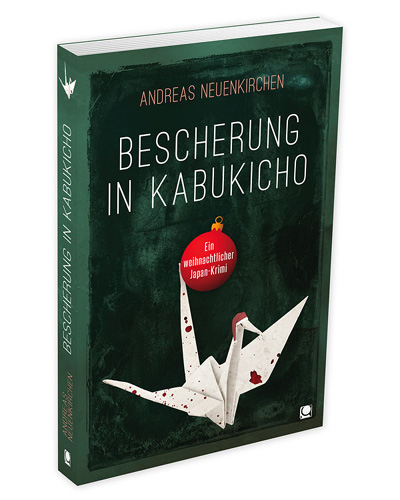
Wie jeder Mensch mit einem schlagenden Herzen in der Brust liebe ich
Luther, obwohl ich einsehe, dass die Serie logisch und psychologisch nicht immer auf dem solidesten Fundament steht und wohl keine Auszeichnungen für Originalität erhalten wird (wie sagte neulich jemand hier im Internet:
finally, a cop show!). Sie ist halt eine Naturgewalt, und Naturgewalten halten sich nicht lange mit Kleinigkeiten wie Psychologie und Originalität auf. Mir persönlich ist naturgewaltiger Thrill jederzeit lieber als Fakten-Fakten-Vorabendkrimi.
Das Versprechen zweier neuer Luther-Folgen ist wie ein Versprechen, dass nun doch noch alles gut wird. Dass die dritte Staffel doch nur die dritte Staffel war, und nicht das Schlusskapitel, als die sie uns zunächst um die Ohren gehauen wurde.
Wir erinnern uns an das Ende mit Schrecken: Luther hatte gerade begonnen, zarte Bande zur klugen, attraktiven, charmanten, furchtlosen Mary zu knüpfen, nur um dann letztendlich doch mit der durchgeknallten Mörderin Alice durchzubrennen. Mary war übrigens entgegen anders lautenden Gerüchten ganz und gar keine langweilige Figur. Es sei denn, man definiert ‚langweilig‘ als: jeder, der kein durchgeknallter Mörder ist. Als wäre dieser Unsinn nicht Unsinn genug, hatte es dem Herrn Serienerfinder und Alleinautor Neil Cross kurz vorher gefallen, mit DS Ripley eine der niedlichsten Nebenfiguren des Ensembles einfach so abzuknallen. Nur, weil Cross seinem Stoff nicht traute (zu Unrecht), und meinte, dass die Serie schon lange keinen ‚Zoe-ist-tot‘-mäßigen Knalleffekt mehr hatte (brauchte sie auch nicht). Zoes Tod in der ersten Staffel war das zentrale Thema der Geschichte. Ripleys Tod in der dritten Staffel ist kaltherziger Unfug, die Geschichte hätte in jedem Aspekt auch ohne funktioniert. Es wurde theoretisiert, Ripleys Tod solle verdeutlichen, dass der Vigilant mit der Schrotflinte, der dafür verantwortlich ist, in echt keiner von den Guten ist. Ich sage: Das wird auch so klar. Die Entführung und angedrohte Ermordung einer hochschwangeren Unschuldigen hat da ausreichend starke Signalwirkung.
Doch der tote Ripley ist nicht das Hauptproblem, sondern die quicklebendige Alice.
Nicht, dass Missverständnisse aufkommen: Alice ist eine pfiffige Figur und wird von der putzigen Ruth Wilson sehr drollig gespielt. Sie hätte ihre eigene Serie verdient. Aber in
Luther ist sie ein Störenfried geworden. Ein faules Requisit, das immer dann rausgeholt wird, wenn Luther sich selbst nicht mehr helfen kann. Sie bombt ihn aus der Haft. Sie tötet stellvertretend den Mörder seiner Frau. Sie tötet den Mörder von Luthers Freund und Kollegen. Sie tötet den Kindermörder, den Luther nur beinahe getötet hat. Die Intention ist klar: Alice symbolisiert Luthers allerdunkelste Seite. Sie ist der veräußerte Schweinehund, den er selbst noch nicht mal dann von der Kette lässt, wenn er Ganoven vom Balkon schubst. Diese Reduzierung allerdings wird Alice‘ Potenzial nicht gerecht. Sie sollte mehr als ein Stellvertreter-Symbol für einen Charakterzug einer anderen Figur sein. Außerdem kann man das, was Luther beinahe tut, und das, was Alice tatsächlich tut, schwerlich auf dieselbe Argumentationskette ziehen. Alice tut, was sie tut, weil sie kein Gewissen hat. Luther hingegen besteht aus so gut wie nichts anderem als Gewissen.
Ob man seine Mittel gutheißt oder nicht: Luther kämpft gegen das Böse. Alice kämpft nur gegen die Langeweile. Wenn nun Luther am Ende der (gottlob vermeintlich) letzten Folge mit Alice Hand in Hand in den Sonnenaufgang spaziert, dann ist das entweder ein Faustschlag ins Gesicht der treuen Zuschauer, oder zumindest eine gepfefferte Backpfeife, je nach Interpretationsansatz.
Interpretationsansatz ‚Faustschlag in das Gesicht des Zuschauers‘: Nach diesem Ansatz hat das Hand-in-Hand-mit-Alice-Ende zu bedeuten, dass Luther nie der war, für den wir ihn gehalten haben. Nie der, für den wir immer wieder eingeschaltet haben. Wenn er mit der durchgeknallten Mörderin durchbrennt, dann war er nie die solitäre stählerne Faust der Gerechtigkeit, sondern nur einer von viel zu vielen. Einer von all diesen öden, blöden Adrenalin-Junkies. Und so einem haben wir unsere Aufmerksamkeit geschenkt? Das hat er nicht verdient. Das haben vor allem wir nicht verdient.
Interpretationsansatz ‚Backpfeife in das Gesicht des Zuschauers‘: Luther war sehr wohl die längste Zeit der, für den wir ihn gehalten haben. Doch auch ein Mann aus Stahl setzt irgendwann Rost an und wird gebrochen. Er musste einfach zu viel einstecken und wusste nicht mehr, was er tat.
Das mag realistisch sein, aber Realismus sollte beim Fernsehen nicht von zentraler Bedeutung sein. Als halbstarker Rabauke hat man für Happy Ends nichts als Spottlieder übrig und gefällt sich darin, die Dunkelheit zu preisen, als wohne ihr eine größere Wahrheit inne als dem Hellen. Mit dem Sammeln von Lebenserfahrungspunkten allerdings schwinden diese Flausen aus den Köpfen und es kommt die Erkenntnis hinein:
Wir schalten den Fernseher ein, um das Licht zu sehen. Eine Figur, die uns über drei Staffeln bei allen gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten ein Freund geworden ist, wollen wir am Schluss nicht als gebrochenen Schwachkopf sehen.
Ich entscheide mich dennoch für diesen zweiten Interpretationsansatz, denn der kann durch die neuen Folgen in Würde widerrufen werden. Wollen wir nicht alles, was geschehen ist, überbewerten. Wir kennen schließlich alle solche Tage: zu wenig geschlafen, zu schlecht gegessen, die Freundin wurde entführt, man selbst des Mordes an einem Kollegen beschuldigt, eine Kugel ins Bein geschossen – da kann es schon mal zu Kurzschlusshandlungen kommen. Ein starker Kaffee, eine Mütze Schlaf, den Verband gewechselt – und Luther ist wieder der Alte. Ich bin guter Hoffnung, dass es so in den neuen Folgen kommt.
Bei der anderen großen Fernsehankündigung dieses Jahres habe ich größere Skepsis.
Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass
Twin Peaks zurückkommt, wurden sofort Erinnerungen an die Große Enttäuschung von 1999 wach. Drei Tage und drei Nächte lang lief damals der Download von
Star Wars – Episode I: The Phantom Menace über den Uni-Server, und als man dann endlich im Freundeskreis einen Computer gefunden hatte, der so was abspielen kann … ach, Sie wissen schon. Heute sind die Internetverbindungen schneller, aber die Menschen nicht kreativer. Selbstverständlich werde ich mir die neuen
Twin Peaks-Folgen ansehen, und wenn sie gut geworden sind, werde ich zufrieden lächeln. Aber zu großen Hoffnungen mag ich mich nicht hinreißen lassen. Nach dem indiskutablen
Inland Empire, den lieb- und einfallslosen Video-, Musik- und Werbewerken der letzten Jahre und seiner beängstigenden wie enttäuschenden Begeisterung für esoterisches Meditationsgedöns halte ich die Hoffnung auf ein überzeugendes neues Werk von David Lynch für in etwa so berechtigt wie die Hoffnung auf ein überzeugendes neues Werk von Dario Argento.
Ich muss außerdem kleinlaut gestehen, dass das gute alte
Twin Peaks in zumindest meinen Augen nicht sonderlich gut gealtert ist. Ich habe damals alles mitgemacht: Private Guck-Partys mit Kirschkuchen und Kaffee organisiert, Quizpreise bei offiziellen Twin-Peaks-Mottopartys in Großraumdiskotheken abgeräumt, und ich hatte das Print-Magazin
Wrapped in Plastic noch abonniert, als das letzte
Secret Diary of Laura Palmer längst verramscht war. Als ich jedoch zur DVD-Veröffentlichung der Serie vor ein paar Jahren die alte Jugendliebe noch einmal neu entflammen wollte, bin ich auf halbem Wege wieder ausgestiegen. Und das obwohl ich stets der stolzen Außenseitermeinung war, dass die zweite Staffel besser gelungen war als die erste; gerade weil so versponnen. Lynch guckt man ja wohl wegen des Lynchigen, nicht weil man wissen will, wer wen wie wo warum umgebracht hat. Dafür gibt es Vorabendkrimis.
Überhaupt wird es so langsam ein bisschen viel mit diesen Nostalgiefortsetzungen. Den
Star Wars-Trailer von neulich erspare ich Ihnen an dieser Stelle, sie kennen ihn bestimmt bereits auswendig.
Star Wars kann mir eh gestohlen bleiben, ich möchte mein Krieg der Sterne zurückhaben. Der Trailer gibt da Anlass zur Hoffnung, das will ich nicht bestreiten. Doch auf Trailer ist immer seltener Verlass. Die Älteren erinnern sich bestimmt noch an die für
Prometheus und
Guardians of the Galaxy. Da stellte sich dann später auch heraus, dass es sich bloß um Filme handelte.
Immerhin sieht der
Star Wars-Trailer danach aus, als hätte man komplett neues Material gedreht. Ganz anders als ein gewisser anderer Nostalgiefortsetzungstrailer, der so aussieht, als hätte man die ersten vier Filme nur neu zusammengeschnitten und die beliebtesten Bonmots von anderen Schauspielern einsprechen lassen.
Überhaupt, Nostalgie. Mit ihr ist es wie mit dem Sterben. Genauer: wie mit den fünf Sterbephasen nach Kübler-Ross. Die ersten beiden Phasen habe ich hinter mir: Die des Nicht-Wahrhaben-Wollen („Nostalgisch? Ich doch nicht! So was passiert nur den anderen!“) und die des Zornes („Ich werde nie zu einer dieser bescheuerten Drei-Fragezeichen-Playback-Lesungen gehen!“). Ich bin jetzt in der Phase des Verhandelns (was nicht heißt, dass ich jemals zu einer dieser bescheuerten Drei-Fragezeichen-Playback-Lesungen gehen werde): Nostalgie lasse ich dann zu, wenn sie sich auf Dinge bezieht, zu denen ich eigentlich gar keinen starken biografischen Bezug habe. Quasi Phantomnostalgie, eine Nostalgie der verpassten Gelegenheiten. Großen Spaß habe ich auf meine alten Tage zum Beispiel mit den Filmen der Reihe
Mad Mission, die ich in jungen Jahren zwar wahrgenommen, aber zunächst nicht angesehen hatte.
Würde jemand in Hongkong diese Serie mal fortsetzen, rebooten oder reimaginieren, würde ich in Sekunden zur glucksenden kleinen Fanperson. Bis dahin gefallen mir die amerikanischen Remakes mit Vin Diesel und Paul Walker allerdings auch ganz gut.