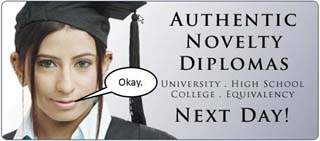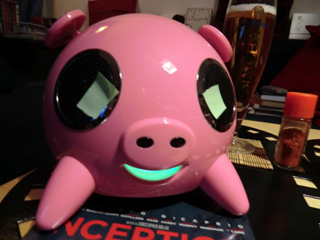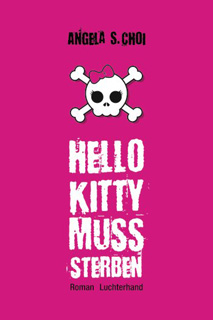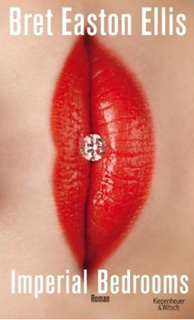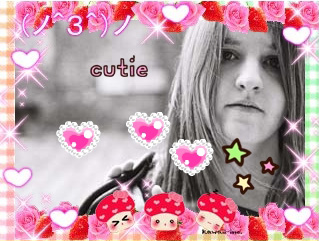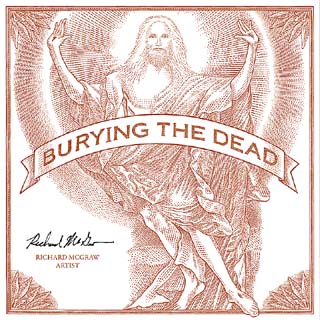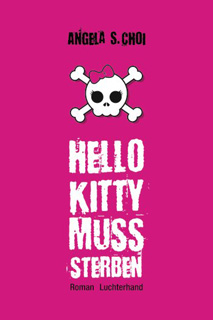
Ich wunderte mich einmal sehr, als eine befreundete Autorin für ein Magazin sehr sachlich eine DVD besprach, deren äußerst infantiler Inhalt im Wesentlichen darin bestand, dass die Filmemacher auf möglichst brutale Weise Teddybären vernichteten. Ich kannte die Autorin als eine Liebhaberin und Bewahrerin von Teddybären, daher meine Verwunderung. Sie aber erläuterte mir, dass sie sich mit einer buddhistisch korrekten Geisteshaltung auch in diesem Zusammenhang an den kleinen Rackern erfreuen könne.
Wenn die das kann, dann kann ich auch ein Buch mit dem entsetzlichen Titel
Hello Kitty Must Die
lesen. Es handelt sich um den Debütroman der Amerikanerin Angela S. Choi, der bald auch
auf Deutsch
erscheint. Choi erzählt von der jungen Anwältin Fiona, die schwer unter ihrer chinesisch verwurzelten Familie zu leiden hat, und darunter, dass sie, Fiona, kein Jungfernhäutchen hat. Das entdeckt sie, als sie sich am Anfang des Romans mithilfe eines Artikels aus dem Ehehygienefachgeschäft selbst entjungfern möchte. Bestürzt rennt sie zum Chirurgen, um sich ein Häutchen einsetzen zu lassen. Der Arzt entpuppt sich als ein ehemaliger Schulkamerad, der seinerzeit von der Schule flog, weil er gerne Leute anzündete. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
So weit, so pfiffig. Es könnte der Beginn eines wunderbaren Romans sein, wenn nicht alles von Anfang an so ermattend unpfiffig geschrieben wäre. Angela S. Choi wird häufig mit Chuck Palahniuk verglichen, hauptsächlich wohl, weil es so auf dem Buchumschlag steht, und der Mensch plappert gerne nach, was schon mal ein anderer Mensch geplappert hat. Mittlerweile ist ein Palahniuk-Vergleich freilich einer, bei dem man sich nicht sicher sein kann, ob er schmeichelhaft oder gehässig gemeint ist. Aber selbst wenn der Name des putzigen Nullerjahrekultautoren inzwischen einiges an Strahlkraft eingebüßt hat, so muss man Palahniuk doch eines lassen: Er hat eine ganz eigene Stimme. Sie mag einem irgendwann auf den Geist gehen, aber sie ist unverwechselbar, in guten wie in schlechten Zeiten. Choi hingegen schreibt im Duktus generischer Chick Lit (nicht Chuck Lit, höhö, Verzeihung). Ihre Ich-Erzählerin soll eine geistreich-sarkastische Beobachterin sein, ist aber bloß ein geistloser Jammerlappen, der sich aus einem Plattitüdenreservoir von unvorstellbaren Ausmaßen vollsaugt. Später gibt es in der Handlung wohl noch Serienmord und Nachtleben, wie in jedem Debütroman, aber so weit bin ich nicht gekommen. Auf Seite 50 dachte ich mir: Das Kapitel noch, dann wieder ein gutes Buch. Gottlob ging das Kapitel nur bis Seite 52.
Viele Menschen brüsten sich damit, jedes Buch, das sie zu lesen beginnen, auch zu Ende zu bringen. Meistens sind das Menschen, die sich um ihr Geld selbst dann noch Gedanken machen, wenn es schon ausgegeben ist. Dann lautet die irrationale Argumentation: Ich hab das bezahlt, also lese ich es auch. Mir kommt diese doppelte Bestrafung nicht in die Tüte. Das Geld mag verloren sein, aber die Zeit kann ich noch retten.
Mit dem thematischen Kreisen ums Töten und Ausgehen in Kalifornien scheint man eher bei Bret Easton Ellis als bei Chuck Palahniuk. Man muss aber nur einen Blick in den neuen Ellis werfen, um zu verstehen, warum man doch ganz woanders ist. Inzwischen gilt zwar als gesichert, dass es sich bei
Imperial Bedrooms
nicht um den größten Wurf des Autoren handelt, aber er ist dennoch ein exzellentes Beispiel für das, was dabei herauskommt, wenn ein ernsthafter Schriftsteller hoch konzentriert das tut, was er besonders gut kann. Das ist ein Rhythmus, bei dem man mitmuss, da stimmt jedes Bild, da steckt hinter jedem kleinen Fehler eine große Absicht. Das hätte kein Imitator so schreiben können, auch wenn sich seit 20 Jahren jeder zweite Nachwuchsautor für den neuen Bret Easton Ellis hält.
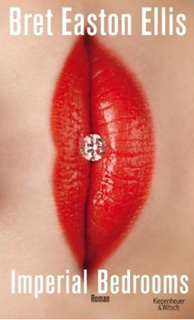
Angela S. Choi dankt in ihrem Buch u. a. ihrem ‚Creative Writing Coach‘. Ich habe dieser Creative-Writing-Chose nie getraut. Wahrscheinlich wird man dabei gecoacht, so viel wie möglich so wenig kreativ wie möglich zu schreiben, damit man so klingt wie jeder andere, der schonmal ein Buch verkauft hat. Das ist näher bei Kerstin Gier als bei Chuck Palahniuk oder Bret Easton Ellis. Meinetwegen ist das Kerstin Gier mit einer Kettensäge, aber Kettensäge ist in diesem Fall leider auch keine Lösung.
Ach, der Kerstin-Gier-Vergleich tut mir schon wieder leid. Die Gier und ihre Vermarkter führen zumindest niemanden an der Nase herum. Wer einen Gier in die Hand nimmt, tut dies nicht, weil er erwartet, das Buch könnte jede Sekunde für den Preis der Leipziger Buchmesse shortlisted werden. Der amerikanische und der deutsche Verlag von Choi tun aber so, als handele es sich um kapitale LITERATUR.
Es müsste einen geben, der mit dem Zeigefinger hoch in der Luft herumschlägt und mit einem feucht lispelnden Quaken ruft: „Das ist keine Literatur!“ Gibt es aber nicht. Muss man selbst machen.
Jetzt bitte nicht das ewige Chick-Lit-Argument, dass das alles eben nicht für Männer gedacht und gemacht wäre. Man nenne mich hoffnungslos progressiv, aber ich weigere mich zu glauben, dass Frauen schon genetisch das literarische Urteilsvermögen fehlt. Es wird Frauen geben, die sich von der Fließband-Frauenliteratur um Schuhe, Sex, Shopping und Serienmord mehr beleidigt als angesprochen fühlen. Ich bin mir ganz sicher, irgendwo gibt es sie. Mein ewiges Mantra.
Zum kritischen Hello-Kitty-Diskurs hat der Roman übrigens wenig Neues beizutragen. Es wird der alte Hut aus dem Schrank geholt, dass Kitty-chan konteremanzipatorisch sei, weil sie keinen Mund habe und somit keine Parolen rufen könne. Choi fügt dem hinzu, dass man ohne Mund auch anderen Aktivitäten nicht nachgehen kann, aber dies ist ein familienfreundlicher Blog. Ich halte dagegen: In einer Gesellschaft, in der niemals niemand nicht aufhört zu schnattern, ist Kitty ein liebenswert unangepasster Freigeist, eine echte Rebellin. Sie kann sich auch ohne Verbaldurchfall verständlich machen, sie ist eine Meisterin der nonverbalen Kommunikation. Ein Blick von ihr oder auf sie sagt alles. Wie jede echte Rebellin bringt Hello Kitty das Establishment verlässlich zur Verzweiflung. Die gleichgeschalteten Schäfchen der Generation Slipknot kann man kaum besser verstören als mit Kittys radikaler und kompromissloser Niedlichkeit. Die Kleine hat es faustdick hinter den Öhrchen. Lang lebe Hello Kitty.

P.S.: Ja, ich habe schon verstanden, dass die Hello Kitty im Roman nicht nur die japanische Stilikone meint, sondern auch den amerikanischen Slang-Ausdruck für fügsame Mausemädchen asiatischer Herkunft. Hat mir und dem Roman aber nicht geholfen.